
Text: Dieter Buhmann
Wissenschaftliche Bearbeitung: Dr. med. Dieter Buhmann
Institut für Rechtsmedizin, Homburg Saar, 1996
Leiter: Prof. Dr. med. Jochen Wilske
Rudolf Kaiser, Arzt und Zahnarzt, Blieskastel
Fotografien: Holger Summa, Institut für Anatomie, Homburg Saar
Webseite: Jan Selmer
Zu Beginn der zahnmedizinischen Untersuchungen
werden alle Kieferabschnitte fotografisch dokumentiert. Anschließend
wird eine Röntgenübersichtsaufnahme von Ober- und Unterkiefer
angefertigt. Die Untersuchung der Zähne und des Zahnhalteapparates
ergibt folgende Befunde:
1.1.1. Oberkiefer [↑]
Die Regio 18 (Weisheitszahn) zeigt eine vollständige
Verknöcherung des ehemaligen Knochenfaches. Im Knochenfach
des 2. Mahlzahnes (Zahn 17) befinden sich auf der rechten Seite
die Reste beider Wurzeln. Der 1. Mahlzahn (Zahn 16) ist wegen
fehlendem Gegenbiß über die ehemalige Kauebene hinaus
gewachsen. Seine Kaufläche ist kariesfrei. Man erkennt deutlich
den bis zum ehemaligen Zahnfleischsaum gelegen Zahnstein, auch
der 2. Vormahlzahn (Zahn 15) ist in gleichem Umfang davon betroffen
(Abb. 1).

Der davor liegende 1. Vormahlzahn (Zahn 14)
ist nur noch als Wurzelrest vorhanden. Die Zähne in der Oberkieferfront
haben dunkle Beläge aus mumifiziertem Weichteilgewebe. Kariöse
Defekte sind auf der labialen Seite nicht nachweisbar (Abb. 2).

Auf der linken Seite ist im Oberkiefer zu Lebzeiten
der Weisheitszahn (Zahn 28) vor langer Zeit verloren gegangen.
Vom zweiten Mahlzahn (Zahn 27) befinden sich nur noch die Wurzelreste
in ihrem Zahnfach. Der 1. Mahlzahn (Zahn 26) weist eine metallisch
glänzende Füllung auf der Außenfläche auf.
Er ist zudem über die Kauebene hinaus gewachsen, da der Antagonist
vor langer Zeit verloren ging ( Abb. 3).

Ferner ist auf der Aufnahme die Fenestration im Bereich der vorderen Zahnwurzelspitze des Zahnes 26 gut erkennbar. Der Zahnsteinbefall an diesem Zahn ist gering, Karies ist nicht nachweisbar.
Die Aufsichtaufnahme der Oberkieferzähne läßt eine deutliche Abkauung im Bereich der Zahnfront erkennen. Hiervon sind insbesondere die seitlichen Schultern der Eckzähne betroffen. Die Abkauung der ersten Oberkieferzähne ist als deutliche zentrale Rillenbildung erkennbar, wobei das Dentin durch die erhebliche Abkauung freigelegt worden ist (Abb. 4). Der 1. rechte Mahlzahn (Zahn 16) hat auf der Kauebene eine zentral liegende metallisch glänzende kleine Füllung. Die Kauflächen der noch vorhandenen Zähne des Oberkiefers sind kariesfrei. In den Grübchen und Rillen der Backenzähne sind geringe Zahnsteinreste vorhanden.
Die Austrittsöffnung (Foramen incisivum)
der Gaumen-Nasennerven (Nn. nasopalatini) ist relativ groß
ausgebildet. Diesem Befund kommt kein Krankheitswert zu.

1.1.2. Unterkiefer [↑]
Der Unterkiefer weist auf seiner rechten Seite
den Verlust des 1. und
2. Mahlzahnes auf Zahn 46 und 47), der lange vor dem Tode eingetreten
ist. Der dahinter liegende Weisheitszahn (Zahn 48) ist durch den
Verlust der Zähne in die entstanden Lücke vorgewandert
und mit der Krone nach vorne gekippt. Der Weisheitszahn hat einen
deutlichen Zahnsteinbefall (Abb. 5).


Die Aufnahme der Unterkieferfront zeigt den
Verlust des 1. rechten Schneidezahnes (Zahn 41) vor langer Zeit
(Abb. 6). Durch diesen Zahnverlust sind die benachbarten Zähne
in die entstandene Lücke gewandert. Hierbei haben die Kronenspitzen
miteinander Kontakt erhalten, wohingegen die wurzelnahen Zahnanteile
noch einen deutlichen Abstand zueinander haben. Die Front der
Schneidezähne zeigt einen mittleren Zahnsteinbefall bis auf
die Höhe des ehemaligen Zahnfleischsaumes. Zudem ist ein
vertikaler Knochenabbau erkennbar im Sinne einer mittelschweren
Paradontose. Nebenbefundlich ist auf der linken Kinnseite noch
etwas mumifiziertes Weichteilgewebe mit vereinzelten Barthaaren
erkennbar.
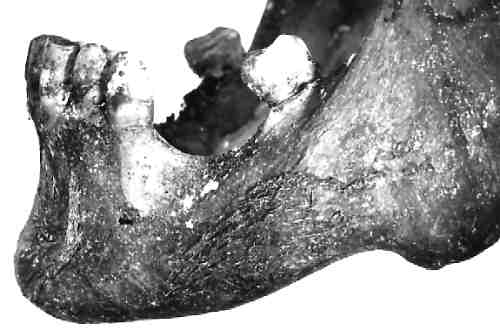
Die Abbildung 7 zeigt die linke Unterkieferseite mit dem Fehlen des 1. und 2. Mahlzahnes (Zahn 36 und 37). Der Kieferkamm ist erheblich zurückgebildet, wie man es typischerweise bei fehlendem Gegenbiß bzw. prophetischem Ersatz dieser Zähne findet. Der Weisheitszahn ist etwas aufgewandert und mit der Krone nach vorne gekippt. An diesem Zahn fehlt Zahnstein fast vollständig. Der Knochenschwund ist geringer als auf der Gegenseite.
Die Aufsichtsaufnahme des Unterkiefers läßt
die erhebliche Abkauung der Frontzähne erkennen (Abb. 8).
Hiervon sind besonders die seitlichen Schultern der Eckzähne
betroffen. Die Abkauung der verbliebenen Vormahl- und Mahlzähne
ist hingegen nur ganz minimal. Dieses erklärt sich durch
das Fehlen der Antagonisten im Oberkiefer. Die Kauarbeit mußte
deshalb fast ausschließlich von den Frontzähnen übernommen
werden.

Die Zahnfächer der verloren gegangenen
Backenzähne auf der linken Seite sind vollständig geschlossen
wie bei Zahnverlust vor langer Zeit. Auf der rechten Seite findet
sich hingegen ein leeres Knochenfach der hinteren Wurzel des 2.
Mahlzahnes. Das Knochenfach der vorderen Wurzel ist hingegen ganz
geschlossen. Dieses bedeutet, daß bei der Extraktion dieses
Zahnes nur die Wurzel mit der Krone entfernt wurde und die hintere
Wurzel als Rest im Kiefer verblieb. Sie ist erst später ausgefallen
oder gezogen worden. Das Knochenfach dieser Wurzel zeigt einen
geringen knöchernen Verschluß, somit ist dieser Wurzelrest
geringe Zeit vor dem Ableben des Fürsten Wilhelm Heinrich
verloren gegangen.
1.2. Radiologischer Befund [↑]
In der Röntgenübersichtsaufnahme
(Orthopantomogramm, OPG, Abb. 9) findet sich im Bereich der Wurzelreste
des zweiten Mahlzahnes auf der rechten Seite eine Zyste an der
vorderen Wurzelspitze. Der Rand der hinteren Wurzelspitze zeigt
eine unscharfe Aufhellung als Zeichen einer chronischen Entzündung.
Der übrige Zahnhalteapparat des Oberkiefers ist entzündungsfrei.
Der Wurzelrest des 2. linken Mahlzahnes ist im oberen Anteil noch
im Verbund. Der erste rechte Mahlzahn ist deutlich über die
Kauebene hinausgewachsen. Die Frontzähne sind ohne Besonderheiten.

Der Unterkiefer weist auf der linken Seite
die deutliche Rückbildung des Kieferkammes auf durch den
Zahnverlust vor langer Zeit. Rechts ist vor dem Weisheitszahn
das leere Knochenfach der hinteren Wurzel des 2. Mahlzahnes erkennbar
(Zahn 47). Dieses ist kolbenförmig aufgeweitet wie bei länger
währender Entzündung.
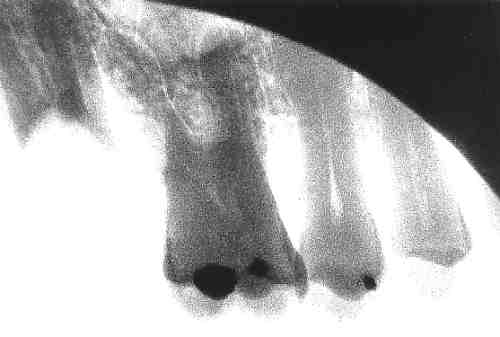
Auffallend sind die zwei Verschattungen des
1. linken Mahlzahnes (Zahn 16), die kleine Verschattung des 2.
linken Vormahlzahnes (Zahn 15) und die Verschattung des 1. rechten
Mahlzahnes (Zahn 26). Hierbei handelt es sich um metallische Füllungen
der betreffenden Zähne (Abb. 10).
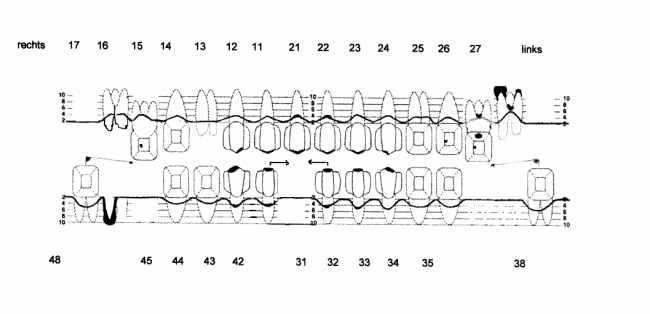
Vorstehend ist das Zahnschema dargestellt.
Die schwarzen Flächen an den Spitzen der Frontzähne
stellen den Grad der Abkauung dar. Die eingezeichneten Punkte
entsprechen den metallischen Füllungen. Die Pfeile über
den Unterkiefer-Frontzähnen zeigen die Wanderung nach dem
Verlust des ersten rechten Schneidezahnes (Zahn 41) und die durchgezogene
Linie auf Höhe der Wurzeln der Zähne dem vertikalen
Knochenabbau zu Lebzeiten. Die Schwärzung an dem Zahn 47
stellt die kolbige Ausweitung im Bereich der Wurzelspitze im leeren
Knochenfach dar. Die Schwärzung an der vorderen Wurzelspitze
des Zahnes 27 zeigt die Zyste in diesem Bereich. Der Ober- und
Unterkiefer selbst ist frei von Tumorgewebe.
1.3. Rasterelektronenmikroskopische Untersuchung des Zahnes 26
1.3.1. Beschaffenheit der Füllung im Zahn 26 [↑]
Der 2. linke Mahlzahn hat auf der Wangenseite
annähernd in der Mitte des Schmelzes der Krone eine kreisrunde
metallisch glänzende Füllung. Der nach vorne weisende
Rand am Übergangsbereich zwischen der Füllung und dem
Zahnschmelz weist kleine halbrunde Defekte auf, die von einer
Zahnbehandlung mittels eines Schabers oder Bohrers herstammen
können (Abb. 11). Die Oberfläche der Füllung ist
bei starker Vergrößerung nicht absolut glatt. Eine
Ursache hierfür ist momentan nicht sicher anzugeben.

Zur Beurteilung der Beschaffenheit der Metallfüllung
wurde der Zahn am Institut für Anatomie, Prof. Dr. med. E.
Mestres, im Rasterelektronenmikroskop untersucht. Hierfür
wurde der Zahn mit Kohlenstoff beschichtet, um eine elektrische
Leitfähigkeit herzustellen. Anschließend wurde er in
die Hochvakuumkammer des Elektronenmikroskopes verbracht. Mit
dieser Untersuchungstechnik ist es möglich, die Verarbeitungsgenauigkeit
der Zahnfüllung zu beurteilen (BERTIN, E.P. 1972, LEYDEN,
D.E. 1983, LEYDEN, D.E. 1984, TERTIAN, R. CLAISSE, F. 1982). Die
Abbildung 12 zeigt die Füllung im Zahnschmelz. Im oberen
Bildanteil ist ein Spalt zwischen der Füllung und dem Zahnschmelz
trotz der hohen Auflösung nicht zu erkennen. Auf der linken
Bildseite sind Teile der Füllung schlierenartig auf den Zahnschmelz
aufgetragen, was von der Verarbeitungstechnik herrühren kann.
Der Zahnschmelz selbst zeigt feine Risse. Diese stammen am ehesten
vom Vakuum der Untersuchungskammer her, da das Vakuum durch Entzug
flüchtiger Bestandteile zu einer fast vollständigen
Austrocknung des Zahnes führt. Die Zahnschmelzdefekte sind
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht zu Lebzeiten vorhanden
gewesen.

Die Abbildung 13 zeigt auf der linken Seite
einen Teilbereich des Randes zwischen der Füllung und dem
Zahnschmelz. Der eingeblendete Maßstab bezieht sich auf
die rechte Bildhälfte. Der gewählte Ausschnitt für
die Vergrößerung ist in der linken Bildhälfte
eingeblendet. Rechts ist die Ausschnittsvergrößerung
abgebildet. Auch hier ist im Randbereich zwischen Füllung
und Zahn nur angedeutet ein Spalt erkennbar. An anderen Randzonen
zeigt sich der Spalt zwischen Füllung und Zahnschmelz etwas
deutlicher (Abb. 14).

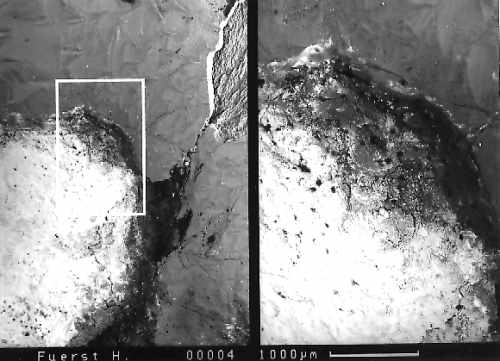
1.3.2. Elementbestimmung der bukkalen Füllung des Zahnes 26
[↑]
Im gleichen Arbeitsgang können im Rasterelektronenmikroskop
mittels energiedispensiver Röntgenfluoreszenz-Analyse (EDXRF)
die Elemente der Metallfüllung zerstörungsfrei bestimmt
werden. Hierbei können nur jeweils kleine Oberflächen
untersucht werden. Die folgenden Spektren zeigen die Elementzusammensetzung
der Füllung des Zahnes 26. Aus der Auswertung der Spektren
kann der Schluß gezogen werden, daß metallisches Zinn
als Material für die Füllung verarbeitet wurde. Ein
derartiger Befund ist für die Saarregion bisher nicht beschrieben
worden.
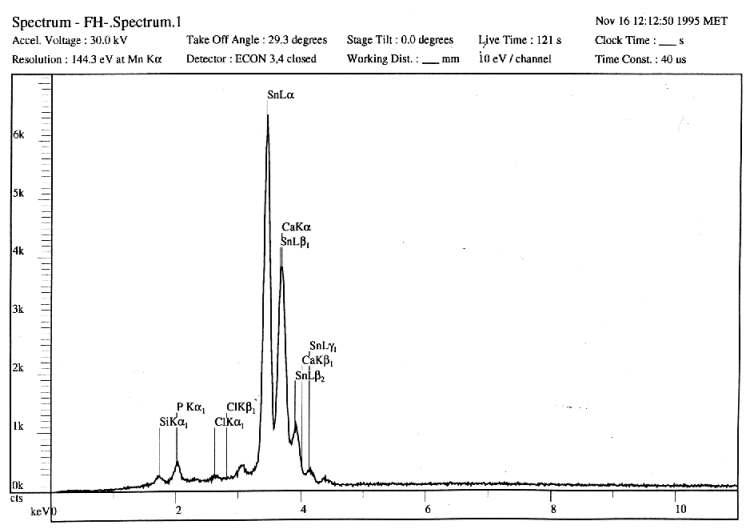
| Spektrum 1 Elements |
Conc. Weight % |
Conc. Atomic % |
Net Intensity |
K-Ratio |
|---|---|---|---|---|
| P Ka | 002,68 | 008,66 | 00025.1 | 0,0087 |
| Ca Ka | 003,83 | 009,56 | 00098.1 | 0,0334 |
| Si Ka | 001,10 | 003,91 | 00008.1 | 0,0027 |
| Sn La | 092,39 | 077,87 | 00531.7 | 0,9552 |
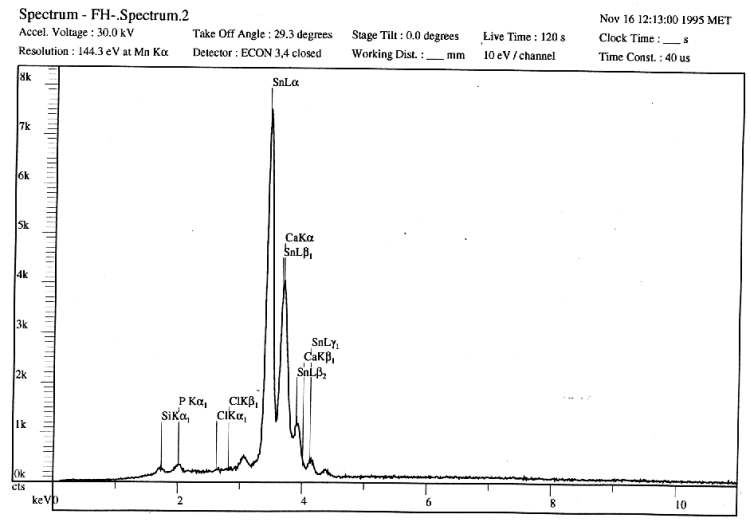
| Spektrum 2 Elements |
Conc. Weight % |
Conc. Atomic % |
Net Intensity |
K-Ratio |
|---|---|---|---|---|
| P Ka | 001,23 | 004,26 | 00012.8 | 0,0039 |
| Ca Ka | 002,09 | 005,60 | 00060.9 | 0,0179 |
| Si Ka | 000,85 | 003,28 | 00007.1 | 0,0020 |
| Sn La | 095,83 | 086,87 | 00628.7 | 0,9762 |
Erste Berichte über das Plombieren von Zahnkavitäten sind uns aus der römischen Zeit überliefert. Der Dichter Martialis (40 - 101) berichtet in einem Gedicht "Eximit aut rificit dentem Cascellius aegrum" "Cascellius zieht den kranken Zahn oder bessert ihn aus". Nach H. L. STRÖMGREN (1935) kann unter reficere auch ersetzen verstanden werden, was auf einen prothetischen Zahnersatz hinweisen würde. Als frühe provisorische Füllungsmaterialien sind bekannt: Wachs, Mastix (das Harz der Pistacia lentiscus zusammen mit Alaun nach dem arabischen Arzt Razih, 10. Jh.), Tacamahac (Harz aus Calophyllum, Asien), Ambra (das Sekret des Pottwales) und Wattekügelchen, welche zuvor in Medikamente getaucht wurden.
Die ersten Metallfüllungen wurden seit
dem 16. Jahrhundert eingebracht. So berichtet Stocker bereits
im Jahre 1528 von der Verwendung des Amalgam als Füllungsmaterial
(P. RIETHE 1966, M. STRAUB 1978). In der Folgezeit wurden Zinn,
Blei, Gold, Kupfer, Vitriol (Kupfersulfat) und Cadmium verwendet
(L. KRÄMER 1968), welche meist als Folien in die Kavitäten
eingebracht wurden und diese dann in vielen Lagen übereinander
fest stopfte, bis die Kavität geschlossen waren. Eine Vorbehandlung
wurde ebenfalls durchgeführt, in dem man die Kavität
ausfeilte und ausbrannte. Um dem Patienten hierbei keine Brandverletzungen
zuzufügen, wurde die Wange mit einem Löffel zur Seite
gehalten. Eine Schmerztherapie vor oder nach einer solchen Behandlung
erfolgte nicht. Die Instrumente, welche man hierbei benützte,
zeigt die Abb. 15 aus dem Lehrbuch von Pfaff, königlicher
Hofarzt, in Berlin im 18. Jahrhundert.
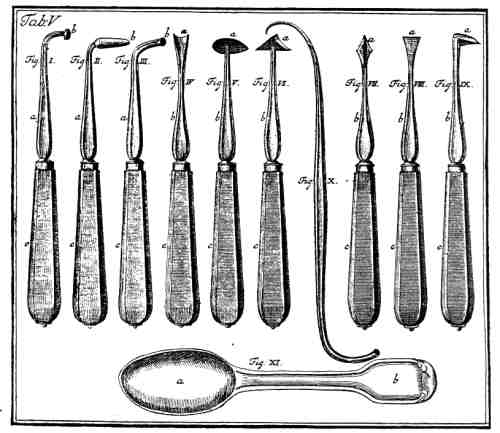
Den ersten Nachweis einer derartigen Füllung gelang P. RIETHE und A. CZARNETZKI im Jahre 1983 bei ihrer Untersuchung der Bestattung der Prinzessin Anna Ursula von Braunschweig und Lüneburg. Sie verstarb im Jahre 1601 im Alter von 28 Jahren in Kirchheim (Württemberg) und wurde in Crailsheim beigesetzt. Die Untersuchung ergab im ersten oberen rechten Mahlzahn eine größere Füllung aus Amalgam und eine kleinere Goldfolienfüllung.
 Einen ersten Nachweis von Zinnfüllungen
konnte K. W. ALT 1993 bei der Untersuchung der historischen Grabfunde
aus Saint-Hippolyte, Le Grand-Saconnex in Genf nachweisen. Bei
der Bestattung aus Grab 37 handelt es sich wahrscheinlich um den
Rechtsanwalt Trosset d'Hericourt aus Paris, der in Genf im Jahre
1761 im Alter von 58 Jahren in Genf verstarb und in Saint-Hippolyte
beigesetzt worden war. Der Zahn 37 wies eine reine Zinnfüllung
auf. Dieser Befund entspricht den Untersuchungsergebnissen am
Zahn 26 von Wilhelm Heinrich.
Einen ersten Nachweis von Zinnfüllungen
konnte K. W. ALT 1993 bei der Untersuchung der historischen Grabfunde
aus Saint-Hippolyte, Le Grand-Saconnex in Genf nachweisen. Bei
der Bestattung aus Grab 37 handelt es sich wahrscheinlich um den
Rechtsanwalt Trosset d'Hericourt aus Paris, der in Genf im Jahre
1761 im Alter von 58 Jahren in Genf verstarb und in Saint-Hippolyte
beigesetzt worden war. Der Zahn 37 wies eine reine Zinnfüllung
auf. Dieser Befund entspricht den Untersuchungsergebnissen am
Zahn 26 von Wilhelm Heinrich.
Es stellt sich somit die Frage, wie es um die
Entwicklung der Zahnmedizin in der ersten Hälfte des 18.
Jahrhunderts, der Lebenszeit von Wilhelm Heinrich und Trosset
d'Hericourt bestellt war. In diese Zeit fällt die Schaffensperiode
des bekanntesten französischen Zahnarztes Fauchard aus Paris
und seiner 30 Schüler, darunter zwei Frauen, welche
im frühen 18. Jahrhundert beginnt. Fauchard gilt als Begründer
der modernen Zahnheilkunde (GREVE, C. 1931). Sein im Jahre 1728
erschienenes Werk wurde bereits 1733 ins Deutsche übersetzt
(FAUCHARD, P. 1733). In Deutschland veröffentlichte Pfaff
im Jahre 1756 seine Abhandlungen von den Zähnen des menschlichen
Körpers und deren Krankheiten (PFAFF, P: 1756). Beide Schulen
betonten die Wichtigkeit der Zahnpflege ebenso wie die Nützlichkeit
von Zahnfüllungen mittels Metallplomben. Beide wußten
gleichermaßen um die unterschiedlichen Eigenschaften der
verschiedenen Metalle, welche für die Plombierungen verwendet
werden konnten, wobei Fauchard dem weicheren Zinn den Vorzug gab,
da ihm hiermit der bessere Verschluß der Kavität möglich
schien. Selbst vor Abrechnungsbetrug hat Fauchard bereits gewarnt,
da einige Scharlatane Zinnfolien mit Safran goldgelb einfärbten
und den Patienten den Preis für Zahngold abverlangten, bevor
sie das Weite suchten.
Man mag geneigt sein zu glauben, bei den erwähnten
Befunden aus Genf und bei Wilhelm Heinrich zwei Patienten
der Pariser zahnmedizinischen Schule vor sich zu haben, da Wilhelm
Heinrich zu Lebzeiten häufig und für längere
Zeit am französischen Hof weilte und der in Genf beigesetzte
Anwalt Trosset d'Hericourt aus Paris stammte. Daß es sich
um Arbeiten von Fauchard selbst handelt, ist eher unwahrscheinlich.
Er wurde im Jahre 1678 geboren und verstarb 1761 mit 82 Jahren.
Würde man unterstellen, daß er die Arbeiten angefertigt
hat, dann hätte er die Plomben im hohen Alter einbringen
müssen. Zudem wären dann die Plomben bei Wilhelm
Heinrich noch weitere 7 Jahre im Zahn verblieben, ohne daß
sich Karies im Randbereich ausgebildet hat. Es erscheint somit
wesentlich wahrscheinlicher, daß eine seiner zwei Schülerinnen
oder einer seiner 28 Schüler die Zahnbehandlung durchgeführt
haben. Die Kontakte Wilhelm Heinrichs nach Berlin waren
nur gering, so daß es wenig wahrscheinlich ist, daß
die Behandlung dort durchgeführt wurde. Die Tätigkeit
eines ausgebildeten Zahnarztes in Saarbrücken für diese
Zeit bisher nicht belegt.
Zu Lebzeiten aufgenommenes elementares Blei
lagert sich im Knochen und im Zahn des Betreffenden ab und bleibt
auch über den Tod in nahezu unveränderter Konzentration
in diesen Substanzen erhalten. Mittels gleicher EDXRF-Technik,
wie sie bei der rasterelektronenmikroskopischen Untersuchung angewendet
wurde, jedoch in einer anderen Vakuumkammer, ist es möglich,
größere Oberflächen auf ihre Elementzusammensetzung
zu untersuchen. Diese Technik hat sich für den Bleinachweis
im Zahn als besonders geeignet erwiesen (TRACOR XRAY INC. 1985,
TRACOR XRAY INC. 1986, WITTIG, W.J. 1960). Die Untersuchungen
führte Herr Prof. Dr. rer. nat. R. Wennig vom Laboratoire
Nationale de Santé in Luxembourg durch. Die Untersuchung
verlief negativ, eine erhöhte Bleibelastung zu Lebzeiten
lag also bei Wilhelm Heinrich nicht vor.
3.2. Interpretation des Ergebnisses der Bleiuntersuchung [↑]
Hohe Bleibelastungen und -vergiftungen kam in damaliger Zeit bei der Bleiverarbeitung, durch das Herauslösen von Blei durch Säuren aus bleihaltigem Zinn und bleihaltigen Glasuren des verwendeten Porzellans oder bei der Verwendung von Bleirohren für das Frischwasser vor (GRANDJEAN, P., JOERGENSEN, P.J. 1990, LYNGBYE, T. 1990, MANUWALD, O. 1989, SHAPIRO, I.M., NEEDLEMAN, H. L., TUNCAY, O.C. 1972, SPECHT, W., FISCHER, K., KATTE, W., BERG, S., HRABOWSKI, H. 1959).
Der negative Befund einer möglichen Bleibelastung
Wilhelm Heinrichs erscheint auf den ersten Blick nicht
erstaunlich. Anders sieht es jedoch aus, wenn man diesen Befund
vor dem Hintergrund der Untersuchungsergebnisse von K. B. M. Louis
(1993) betrachtet. Er untersuchte die Skelettfunde aus der Stiftskirche
St. Arnual in Saarbrücken, in der u.a. auch die Grafen von
Nassau-Saarbrücken, die Vorfahren von Fürst Wilhelm
Heinrich, beigesetzt worden sind. Er konnte durch seine Untersuchungen
zur Bleibelastung feststellen, daß 24 Personen, welche alle
der Neuzeit zuzuordnen waren, teilweise extrem hohe Bleiwerte
aufwiesen entsprechend einer chronischen Bleivergiftung. Bei Abwägung
aller Möglichkeiten führte er diese Bleivergiftungen
auf den Einbau von Bleirohren im Schloß der Grafen zurück.
Einer derartigen Exposition hätte dann jedoch auch Wilhelm
Heinrich ausgesetzt gewesen sein müssen. Der Nachweis
einer fehlenden Bleibelastung Wilhelm Heinrichs muß
somit zu einer neuen Betrachtungsweise der Ergebnisse von M. Louis
über die Ursache der hohen Bleiexposition seiner Skelettfunde
führen.