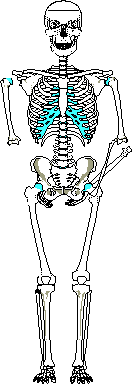
Text: Dieter Buhmann
Wissenschaftliche Bearbeitung: Dr. med. Dieter Buhmann, cand. med. Angelika Kuntz
Institut für Rechtsmedizin, Homburg Saar, 1996
Leiter: Prof. Dr. med. Jochen Wilske
Fotografien: Holger Summa, Institut für Anatomie, Homburg Saar
Webseite: Jan Selmer

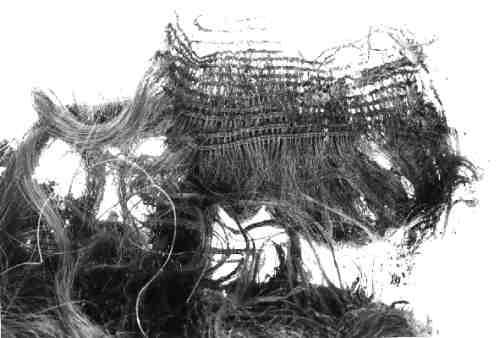
Das knöcherne Schädeldach ist mittels
Sägeschnitt eröffnet, die Sägeschnittfläche
erscheint dunkelbraun, Stufenbildungen an der Sägeschnittfläche
sind nicht erkennbar. Die Stirn sowie die Jochbeine und der Unterkiefer
weisen mumifizierte Weichteilreste auf. Von den Augenbrauen sind
die Haare teilweise erhalten, außerdem finden sich noch
vereinzelte kurze Barthaare am Kinn. Der Unterkiefer ist vom Schädel
gelöst und liegt etwas weiter unterhalb der Schädelbasis
der Halswirbelsäule auf. Alle zu Lebzeiten noch vorhanden
gewesenen Zähne sind in ihren Zahnfächern.
Sie sind auf den äußeren (labialen
und bukkalen) Seiten mit bräunlichen vertrockneten Weichteilresten
teilweise bedeckt. Die freiliegenden Knochenteile haben eine schwärzliche
Farbe.
Der Halswirbelsäule liegen das Zungenbein,
der verknöcherte Kehlkopf und der verknöcherte Ringknorpel
auf. Sie zeigen keine Zeichen einer Gewalteinwirkung zu Lebzeiten
oder nach dem Tode. Sie sind von dunkelbrauner Farbe. Die Halswirbelsäule
liegt gestreckt und die vorderen Wirbelkörperkanten haben
zum Teil degenerative Veränderungen. Der 4. Halswirbelkörper
hat auf der linken Seite eine lippenartige Ausziehung nach unten
(Abb. 3). Im Gegensatz zum Schädel ist die Halswirbelsäule
von hellbrauner Farbe.

Der linke Unterarm ist etwas abgewinkelt, das
Ellbogengelenk liegt unter einem Teil eines der linken seitlichen
Sargbretter. Die Speiche (Radius) und die Elle (Ulna) des linken
Armes liegen nicht mehr im anatomischen Verbund. Die Knochen der
linken Hand liegen über der linken Beckenschaufel und befinden
sich nicht mehr in ihrer anatomischen Position zueinander. Der
rechte Oberarmknochen (Humerus) liegt dem Brustkorb eng an. Die
rechte Speiche und die rechte Elle fehlen. Knochen des rechten
Handgelenkes, der Mittelhand und der Finger liegen im Bereich
des Beckens. Sämtliche Armknochen haben eine schwarzbraune
Farbe. Verfärbungen an den Fingerknochen und an der Elle
und Speiche des linken Armes, die auf das Tragen eines Kupfer-
oder Bronzeschmuckes hindeuten würden, lassen sich nicht
nachweisen.
Die Brust- und Lendenwirbelkörper liegen
achsengerecht zueinander unter einer dickeren Schicht schwärzlich-krümeligen
Materials, welches von einer weiteren sehr dünnen schwarzen
Schicht überdeckt ist. Hierbei kann es sich um ein Stoffgewebe
handeln, welches durchsetzt ist mit Anteilen von menschlicher
mumifizierter Haut. Reste von inneren Organen der Brustkorbhöhlen
und der Bauchhöhle haben sich nicht erhalten. Nahtmaterial
im Bereich der ehemaligen Bauchhaut im Sinne einer postmortalen
Körpereröffnung und anschließendem Verschluß
der Haut mittels einer Naht ist nicht nachweisbar.
Das Brustbein und die Rippen liegen regelrecht
zueinander. Sie weisen keine Beschädigungen auf. Die Brust-
und Lendenwirbelkörper haben eine hellbraune Farbe, die Rippen
sind schwarzbraun und das Brustbein ist mittelbraun.
Die Darmbeine und das Kreuzbein sind mit einer
dicken, schwärzlichen, krümeligen Substanz bedeckt,
die sehr leicht ist. Dieses Material hält relativ fest zusammen
und erst bei etwas stärkerem Druck zerfällt es in kleinste
Partikel. Man gewinnt den Eindruck, daß es sich um Holzmehl
handeln kann.
Beide Oberschenkelknochen (Femora) liegen ausgestreckt
und die Hüftköpfe befinden sich in den Hüftpfannen.
Die Kniescheiben liegen regelrecht auf den unteren Anteilen der
Oberschenkelknochen. Das linke Schien- und Wadenbein sind im unteren
Anteil in einem beigefarbenem Strumpf, der leicht heruntergezogen
scheint. Er hat auf Höhe des Innenknöchels einen größeren
Defekt, und das Sprungbein (Talus) liegt außerhalb des Strumpfes
neben diesem Defekt. Die Knochen des linken Fußes scheinen
nicht mehr im anatomischen Verbund zu liegen. Die Abbildungen
4 und 5 zeigen den linken Strumpf von der Fußinnenseite,
die Abbildung 6 den rechten Strumpf von der Fußaußenseite.
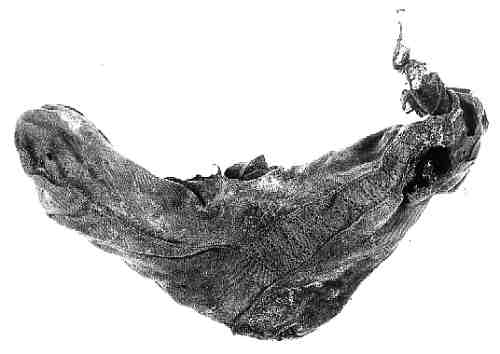


Das rechte Wadenbeinköpfchen ist fest mit dem Schienbeinkopf seitlich verwachsen (Abb. 7). Die untere Hälfte des rechten Wadenbeins ist sehr brüchig und morsch in der Konsistenz, so daß es bei leichter Berührung zerbricht. Es ist von den langen Röhrenknochen am weitesten in Zerfall übergegangen. Die unteren Anteile des rechten Schien- und Wadenbeines stecken ebenfalls in einem beigefarbenen Strumpf. Auch beim rechten Fuß scheinen die Knochen sich nicht mehr in ihrer normalen anatomischen Lage zu befinden. Sämtliche Beinknochen sind von schwarzbrauner Farbe.

Für weitere Untersuchungen wird das gesamte
Skelett vorsichtig aus dem Sarg genommen. Die Fußknochen
verbleiben in den Strümpfen. Für die Bergung der Strümpfe
mit den Fußknochen wird ein dünner Karton unter den
Strumpf geschoben, damit eine weitere Verschiebung der Knochen
zueinander nicht möglich ist.
Alle Knochen sind relativ schwer durch eine
erhebliche Feuchtigkeit, die sie in der Gruft aufgenommen haben,
ebenso sind die Teile der Sargausstattung sehr feucht bis naß.
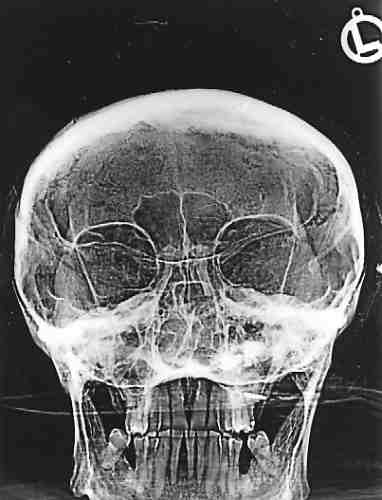
3.1. Schädel [↑]
Die Röntgenaufnahme des Schädels
zeigt, bis auf die Eröffnung des Schädeldaches post
mortem, keine Zeichen von Gewalteinwirkungen oder Tumorbildungen
(Abb. 8). Die Schädelbasis ist intakt, ebenso sind die Knochen
des Mittelgesichtes ohne krankhafte Veränderungen. Die Stirnhöhlen
und die Nasennebenhöhlen sind unauffällig.
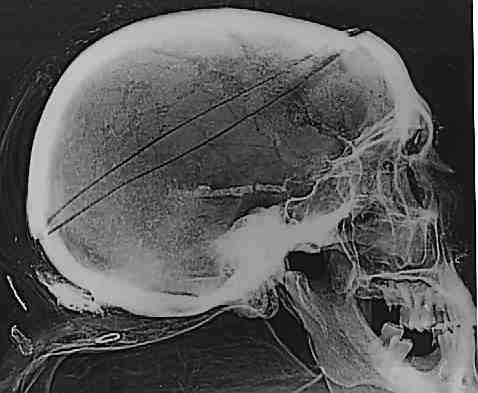
3.2. Unterkiefer [↑]
Der Unterkiefer zeigt keine alte Frakturen
und Tumorbildungen. Die Gelenkflächen der Kieferköpfchen
sind unauffällig (Abb. 9).
3.3. Wirbelsäule [↑]
Die Halswirbelsäule zeigt entlang des
vorderen Längsbandes deutliche degenerative Veränderungen,
hiervon sind insbesondere die Halswirbelkörper 4, 5 und 6
betroffen. Der 7. Halswirbelkörper ist an der Vorderkante
zum 1. Brustwirbelkörper hin als kleine Knochenlippe ausgezogen
(Abb. 10). Die kleinen Gelenkflächen der Halswirbelkörper
sind annähernd frei von degenerativen Veränderungen.
Die Öffnungen für die Nackenarterien zeigen seitengleiche
Durchmesser ohne Zwischenstegbildungen.
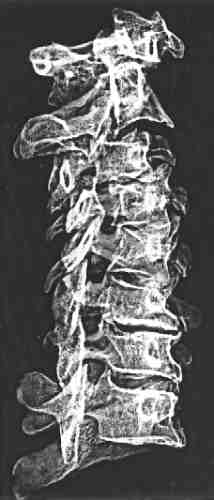
Abb. 10: Seitliche Röntgenaufnahme der Halswirbelsäule.
Die Brustwirbelsäule weist in der Seitenaufnahme
geringe degenerative Veränderungen auf, bezogen auf den 4.
und 5. Brustwirbelkörper. Die Brustwirbelkörper 5 bis
12 zeigen jeweils annähernd in Wirbelkörpermitte geringe
Gefügeaufhellungen, wie bei beginnendem Knochenschwund (Osteoporose,
Abb. 11).
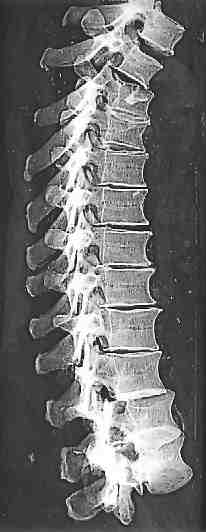
Abb. 11: Seitliche Röntgenaufnahme der Brustwirbelsäule.
Die Dornfortsätze weisen keinerlei Zeichen
alter Frakturen oder krankhafte Veränderungen auf. Die Lendenwirbelsäule
ist überwiegend frei von degenerativen Erkrankungen. Der
5. Lendenwirbelkörper zeigt keine Verwachsungen zum Kreuzbein.
Der gesamte Rückenmarkskanal der Wirbelsäule ist unauffällig.
3.4. Brustkorb [↑]
Die Rippen sind sämtlich frei von Zeichen
alter Frakturen oder Geschwulstumwandlungen. Die Ansatzstellen
zum jeweiligen Rippenknorpel sind teilweise etwas länglich
ausgezogen. Sie zeigen keine Zeichen einer Durchtrennung, wie
man sie bei der Eröffnung des Brustkorbes im Rahmen von Leichenöffnungen
typischerweise findet, dieses gilt auch für das Brustbein.
Es hat einen anatomisch regelrechten Aufbau. Sämtliche Teile
des Brustbeines sind miteinander knöchern verwachsen. Die
Gelenkflächen zu den Schlüsselbeinen sind mit arthrotischen
Ausziehungen versehen. Die Schlüsselbeine sind frei von alten
und frischen Brüchen, sie sind relativ zierlich ausgebildet
und der Ansatz zum großen Kopfwendemuskel ist geringfügig
ausgezogen. Die Schulterblätter sind, bis auf kleine Anteile
der inneren Ränder, frei von Beschädigungen und krankhaften
Veränderungen.
3.5. Obere Extremitäten [↑]
Die Oberarme zeigen röntgenologisch eine
normale Knochenstruktur, die Knochennarben der ehemaligen Wachstumsfugen
an den Oberarmköpfen sind noch deutlich als Verdichtungen
zu erkennen. Alle Gelenkflächen sind frei von arthrotischen
Veränderungen. Gleiches gilt auch für die Speiche und
die Elle des linken Armes. Von der linken Hand sind die vier großen
Handgelenksknochen vorhanden sowie sämtliche Mittelhandknochen
und der Grundstrahl des Daumens. Die Knochen von Zeige- und Ringfinger
sind ebenso vollständig vorhanden und vom Kleinfinger die
beiden körperfernen Glieder. Die übrigen Handknochen
fehlen. An allen Handknochen liegen keine krankhaften Veränderungen
vor.
Bei der rechten Hand liegen ebenfalls die vier
größeren Handgelenksknochen vor sowie die Mittelhandknochen
von Zeige-, Mittel- und Ringfinger. Vom Kleinfinger ist lediglich
das Endglied vorhanden, vom Daumen das Grund- und Endglied. Alle
anderen Handknochen fehlen. Sämtliche Fingerknochen sind
frei von krankhaften Veränderungen.
3.6. Becken [↑]
Die Darmbeine sind typisch männlich ausgebildet
(Symphysenwinkel, Form des Foramen obturatum, Gelenkfläche
zum Os sacrum). Ihnen haften noch Reste von mumifiziertem Weichteilgewebe
an. Das Kreuzbein ist männlich ausgebildet. Der Rückenmarkskanal
ist anatomisch regelrecht. Krankhafte Veränderungen oder
Zeichen von Gewalteinwirkungen lassen sich an den Beckenknochen
nicht feststellen.
3.7. Untere Extremitäten [↑]
Die Oberschenkelknochen haben eine anatomisch regelrechte Struktur. Das Bälkchenwerk (Spongiosa) zeigt eine kräftige Ausbildung, entsprechend einer ständigen Druckbelastung zu Lebzeiten. Die Knochennarben der ehemaligen Wachstumsfugen sind als dichte Linie in den Oberschenkelköpfen deutlich erkennbar. Arthrotische Veränderungen der Hüftköpfe sind nicht gegeben. Am rechten Oberschenkel findet sich innenseitig auf der Gelenkfläche zum Schienbeinkopf eine kleine arthrosebedingte Knochenrandleiste.
 Abb. 12: Röntgenbild des rechten Unterschenkels.
Im unteren Drittel ist eine Knochenverdichtung durch Wachstumsstillstand
erkennbar, das Wadenbeinköpfchen ist mit dem Schienbein
verwachsen.
Abb. 12: Röntgenbild des rechten Unterschenkels.
Im unteren Drittel ist eine Knochenverdichtung durch Wachstumsstillstand
erkennbar, das Wadenbeinköpfchen ist mit dem Schienbein
verwachsen.
Die Knochenstrukturen des linken Schienbeines
sind in der äußeren Knochenschicht und im Bälkchenwerk
entsprechend den anatomischen Gegebenheiten ausgebildet. Im Übergangsbereich
vom mittleren zum unteren Drittel findet sich bei beiden Schienbeinen
eine knochendichte, waagerecht verlaufende Linie, (sog. Harris-Linie,
Abb. 12).
Sie entsteht bei einem Stillstand des Knochenwachstums
während der körperlichen Entwicklung im frühen
Lebensalter, hervorgerufen durch eine längerzeitige Streßsituation
für den Körper. Die Hauptursachen hierfür sind
Nahrungsmangel oder Erkrankungen über längere Zeit.
Auch physische Belastungen können zu vergleichbaren Befunden
führen. Der Abstand der Linie zur Mitte des Schienbeines
weist auf das 3. - 4. Lebensjahr hin, in der Fürst Wilhelm
Heinrich eine derartige Streßsituation erlebt hat. Das linke
Wadenbein ist frei von Zeichen krankhafter Veränderungen.
Bei der röntgenologischen Darstellung des rechten Schienbeines
findet sich eine knöcherne Verwachsungszone zum Wadenbeinköpfchen
hin (Abb. 12 ), als Folge einer traumatischen Schädigung
des Wadenbeinköpfchens. Das rechte Schienbein ist ansonsten
frei von degenerativen Veränderungen und Geschwulstumwandlungen.
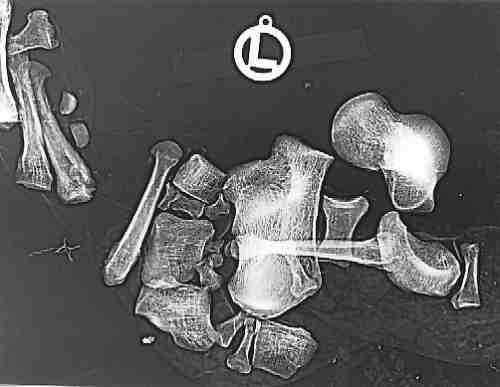
Die Fußknochen werden jeweils in den
Strümpfen belassen und ohne weitere Veränderungen der
Knochenlage zueinander geröntgt. Hierbei stellen sich die
Knochen des linken Fußes in ihrer Lage zueinander vielfach
verlagert dar (Abb. 13).

Die Knochenstrukturen sind frei von krankhaften
Veränderungen. Beide Sesambeine des Mittelfußknochens
der Großzehe haben sich erhalten. Die Knochen des rechten
Fußes liegen in ihrer anatomischen Ausrichtung überwiegend
noch regelrecht, lediglich die Zehenglieder sind gegeneinander
in größerem Ausmaß verlagert (Abb. 14).
Die beiden Sesambeine des Mittelfußstrahles
der Großzehe liegen in ihrer achsengerechten Position. Krankhafte
Veränderungen liegen an allen Fußknochen nicht vor.
Auf der Röntgenaufnahme des rechten Fußes läßt
sich die fragmentarische Zerfallssituation des unteren Drittels
des Wadenbeines gut erkennen. Beide Strümpfe
ergeben einen ganz schwachen Röntgenkontrast, der auf der
digital aufgearbeiteten Röntgenaufnahme erkennbar wird. Auf
der Normalröntgenaufnahme ist das Gewebe der Strümpfe
nicht sichtbar.
| links | rechts | ||
|---|---|---|---|
| Oberarm | (Humerus) | 33 cm | 33 cm |
| Speiche | (Radius) | 25 cm | fehlt |
| Elle | (Ulna) | 26,5 cm | fehlt |
| Oberschenkel | (Femur) | 46 cm | 46 cm |
| Schienbein | (Tibia) | 37,2 cm | 37,2 cm |
| Wadenbein | (Fibula) | 37 cm | 37 cm |
| Schlüsselbein | (Clavicula) | 14 cm | 14 cm |
| Brustbein | (Sternum) | Länge | 11,6 cm | Breite des Manubriums | 7 cm |
|---|---|---|---|---|---|
| Schulterblätter | (Scapulae) | Länge | 15,5 cm | Breite | 9,6 cm |
Die Berechnung der Körpergröße
mit den Längen der Röhrenknochen erfolgt nach den Formeln
nach HUNGER und LEOPOLD (1978). Diese Berechnungsart wurde gewählt,
um die Körpergröße mit früheren Untersuchungen
von archäologisch geborgenen Skelettserien aus dem Saarland
zu ermöglichen. Die berechnete Körpergröße
beträgt 162,2 cm +/- 2,87 cm. Diese Größe steht
in Einklang mit den Worten des Försters Bühler, der
Fürst Wilhelm Heinrich persönlich gekannt hatte.
Er sagte, daß er von Statur "klein ... gewesen ist"
(zitiert nach H.-W. Hermann 1968).